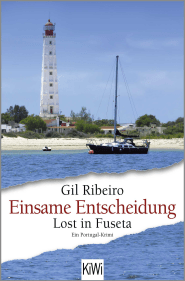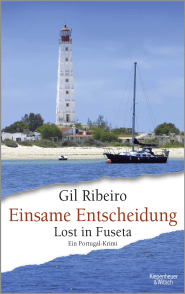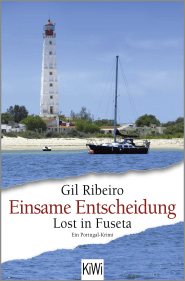XXL Leseprobe zu Gil Ribeiros »Einsame Entscheidung«
1. Kapitel
Es war die Nacht des Tausendsassas. Die frühsommerliche drückende Hitze des 4.Juni hatte Fuseta, das kleine Fischerdorf an der Algarve, den ganzen Tag über fest im Griff. Den 32 Grad am Nachmittag wichen viele Bewohner an die Ufer der Lagune aus. Und wem das Wasser dort zu ruhig oder zu warm war, der ließ sich von den Barkassen und Wassertaxis zu den vorgelagerten Stränden übersetzen, wo der Atlantik seine sanften Wellen unermüdlich ans Ufer warf. Wer im Dorf zu tun hatte, flüchtete sich unter einen Sonnenschirm oder wenigstens in den Schatten einer Pinie, in ein Café oder in eines der Bistros vorne an der Promenade. Die Katzen erholten sich immer noch unter den geparkten Autos von dem nächtlichen lautlosen Durchstreifen ihres Reviers. Die Hunde dösten in schattigen Ecken auf den abgewetzten Steinen der Gassen.
Ein wolkenloses Azur spannte sich über den kleinen Ort und das Meer, bis die Dämmerung sich mit einem feinen, gelben Streifen am Horizont ankündigte. Ein Azur übrigens, das es nur hier an der Sand-Algarve gab, wie die Bewohner wussten. Doch heute zogen von Südwest Wolken als Vorboten der Nacht auf. Die Sonne, die schon hinter der dünnen Linie zwischen Himmel und Wasser verschwunden war, bestrahlte sie von unten mit einem intensiven Rot. Es war, als stünde der Himmel in Flammen.
Erst jetzt, da die Hitze langsam wich, füllten sich die Gassen Fusetas mit Leben. Die sinkende Temperatur war wie eine stumme Verheißung, die die Einwohner und die wenigen Touristen aus ihren Wohnungen und Häusern lockte. Einige flanierten an der Lagune entlang bis hinüber zum Kanal, an dem die Boote vertäut lagen, deren Besitzer sich zum Aufbruch in die Nacht bereit machten, um draußen einsam jene Meerestiere zu fangen, die am nächsten Morgen in der Markthalle angeboten wurden. In den schmalen, verwinkelten Straßen fuhren junge Männer mit ihren hübschen Sozias waghalsige Kurven auf knatternden Mopeds, deren Zweitaktergemisch noch Minuten später schwer in der Luft hing. Nachbarinnen unterhielten sich auf dem Trottoir, und ganze Familien zogen los, um mit Freunden eine gute Zeit zu haben. Die Bars und Restaurants füllten sich und über Fusetas Häusern stiegen kleine Rauchsäulen auf. Sie verbreiteten den Geruch von gegrilltem Fleisch und Fisch. Einige Lokale boten in ihren winzigen Räumen nur Platz für zwei oder drei Tische, deshalb bestuhlten sie einfach die Bürgersteige und bereiteten ihre Köstlichkeiten auf Grills zu, so groß wie Steinway-Flügel.
In diese abendliche Stimmung mischte sich der Tausendsassa. O faz-tudo. Wie ein Chamäleon, das sich nicht der jeweiligen Umgebung anpasste, sondern der jeweiligen Situation.
Er trat aus seiner unscheinbaren Werkstatt in der Rua da Paiol, in der er offiziell wie inoffiziell alles und nichts reparierte, während sein eigentliches Geschäft in der Etage darüber stattfand, die er alleine bewohnte. Victor Pais war 34 Jahre alt, ging aber locker als 30 durch. Eine schmale Erscheinung mit einem jungenhaften Grinsen, das um seinen Charme wusste und es zugleich in einer Weise einsetzte, dass die Leute ihm deshalb trotzdem nicht böse sein konnten. Er trug weiße Turnschuhe, Jeans und ein halb offenes Hemd. Auf seiner braun gebrannten Brust klimperten drei Ketten, wenn er sich bewegte, und im Moment bewegte er sich Richtung Osten.
Keine zweihundert Meter weiter traf er an der Hauptstraße einen gedrungenen Kerl, der rauchte und dessen allgegenwärtiges Misstrauen sich in Form tiefer Falten an der Nasenwurzel in sein Gesicht graviert hatte.
»Olá – du bist der Tausendsassa, hm?«, stellte der Mann fragend fest und musterte ihn dabei eher mit Neugierde als mit Interesse. Wie ein seltenes Tier, von dem man sich erzählte, das man aber noch nie selbst zu Gesicht bekommen hatte.
Victor Pais nickte: »Genau. Und jetzt?«
»Jetzt gehen wir ein paar Meter.«
»Kontakt«, stellte Leander Lost fest.
Er sprach zwar leise, aber da er und die Kollegen mit Intercoms untereinander verbunden waren, hörten ihn die anderen einwandfrei. Jeder von ihnen hatte das winzige Mikro an unterschiedlicher Stelle platziert. Lost unter seiner schwarzen schmalen Lederkrawatte, Graciana Rosado, seine Chefin, hinter dem Anhänger ihrer Halskette und seine Kollegen Carlos Esteves und Miguel Duarte unter den spitzen Ausläufern ihrer Kragen.
Die Empfänger – Wunderwerke der Nanotechnik – ruhten von außen kaum sichtbar in ihren Ohrmuscheln. Eigentlich war der Etat der Polícia Judiciária, der Kripo in Faro, für solcherlei Ausrüstung so überschaubar wie die Arktis, aber Graciana hatte mit der ihr eigenen Nachdrücklichkeit auf deren Anschaffung bestanden. Sie bekam dann diesen Blick, dessen Missachtung vor vielen Jahren den Nachbarsjungen um einen Schneidezahn erleichtert hatte. Da war Graciana elf. Der Blick hatte an Intensität nichts eingebüßt.
»Kontakt mit V2«, präzisierte Leander Lost jetzt, da der Untersetzte aus dem Schatten eines Gebäudes in den gelblichen Lichtkegel einer Laterne trat.
Die anderen wussten, wem V2 zuzuordnen war. V2 war der Funkcode für Bruno Melo. Ausnahmsweise hatte bei der Einsatzbesprechung im Kommissariat Einigkeit über die Stimmigkeit des Namens »Bruno Melo« geherrscht. Er bildete die Statur des Mannes ebenso ab wie das Maß seines Frohsinns – jemand hatte anlässlich seiner Taufe prophetische Weitsicht bewiesen, fanden sie.
Victor Pais und der bullige Bruno Melo, der es sich offenbar zur Lebensaufgabe gemacht hatte, miese Laune in die Welt zu tragen, folgten der Straße zur Lagune hin. Weg von dem Platz der Republik, dem kleinen Zentrum des Ortes, an dem die Tische der vier Restaurants zum Bersten gefüllt waren. Stimmengewirr, Fadomusik und Lachen verdichteten sich zu dem Singsang eines ausgelassenen Abends.
Dort, an einer Ecke des Platzes, stand Leander Lost, wie immer im schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Eine schlaksige, hagere Gestalt, die die dunklen Haare zweckmäßig kurz trug. Er war 34 Jahre alt und unterbot den Tausendsassa in puncto Jugendlichkeit, denn mit seinem nahezu faltenfreien Gesicht hätte man ihn auch für 28 halten können. Immerhin war er nun, nach bald zwei Jahren an der Algarve, nicht mehr mit jener aristokratischen Blässe geschlagen wie zu Beginn.
Er lehnte an einer gelben Ducati Scrambler, einem Motorrad im Retro-Look, und verfolgte den Weg, den Bruno Melo einschlug, aus den Augenwinkeln. Zu gerne hätte er genau hingeschaut, aber Graciana und Carlos hatten ihm eingeschärft, das zu unterlassen. Denn er neigte zum Starren. Und er wusste: Menschen spüren ganz genau, wenn sie intensiv beobachtet werden. Dennoch kostete es Leander einige Mühe, seinem Impuls nicht nachzugeben, er presste seine linke Hand so stark zur Faust, dass die Knöchel weiß hervortraten.
»V1 und V2 sind gleich außer Sicht. Ich wiederhole: V1 und V2 sind gleich …«
»Ich sehe die beiden«, unterbrach Carlos Esteves ruhig. Er saß allein an einem der roten Plastiktische des Bistros Sport Lisboa e Fuzeta, das auf seiner ausgeblichenen Markise immer noch den ursprünglichen Namen des Fischerdorfs trug.
Der Sub-Inspektor war ein kräftiger, aber nicht muskulöser Kerl, der in sich ruhte. Das dunkle, gelockte Haar fiel ihm bis in den Nacken. Ein leicht zerknittertes Leinenjackett spannte sich über sein Kreuz, darunter ein weißes Shirt und helle Bluejeans, die an einem Knie einen Schlitz aufwiesen. Etwas, was gerade wieder in Mode kam, aber Carlos war mit seiner Vespa lediglich an einem Stacheldrahtzaun hängen geblieben.
Von hier, der Straßenecke aus, hatte Esteves alles im Blick. Sowohl die Hauptstraße, auf der ihm Pais und Melo entgegenkamen, als auch die Straße am Campingplatz vorbei zur Lagune. Falls der Tausendsassa und sein Begleiter nach links abbogen, würde Graciana Rosado dort hinter dem Steuer eines Ford Mustang in der Bullitt-Edition warten, dem so schnell nichts entwischen konnte.
Bogen sie dagegen nach rechts ab, würde Esteves sich hinter sie klemmen. Er und Graciana waren in Fuseta aufgewachsen, sie kannten jeden Winkel, jede Abkürzung und jeden Durchgang. Carlos konnte also hinter Melo und Pais verschwinden und eine Straße vor ihnen wieder auftauchen, wenn es drauf ankam.
Kam es aber nicht.
Sie bogen nach links ab, zum Kanal hin.
»V2 außer Sicht«, hörte er Leander Lost, dessen Umriss er selbst aus dieser Distanz neben der Scrambler ausmachen konnte.
V2.
Esteves schüttelte den Kopf und spießte mit der Gabel die letzten drei Scheiben der Chouriço auf, die der Koch des Bistros auf dem Grill für ihn flambiert hatte – das Gericht stand nicht auf der Karte, aber wem tat ein kleiner Gefallen für einen SubInspektor schon weh? –, und schob sie sich in den Mund.
V2. Auf so etwas konnte nur der Alemão kommen.
»Warum sollen wir ihn nicht beim Namen nennen?«, hatte Carlos ihn im Büro der Polícia Judiciária gefragt. »Der Mann heißt Bruno Melo.«
»Das entspricht dem Funkstandard der Polizei«, bekam er prompt zur Antwort, »falls jemand auf unserer Frequenz mithört, wissen wir, wer sich hinter V2 verbirgt – aber der Mithörer nicht.«
»Abhören? Wer sollte uns denn abhören? Bruno Melo ist ein gewöhnlicher Krimineller, der denkt nicht so weit.«
»Ich verstehe, er denkt nicht weit.«
»Genau.
»Und der, zu dem er uns führt? Denkt der auch nicht so weit? V3?«
Carlos Esteves holte Luft für eine flapsige Erwiderung, aber Graciana Rosado kam ihm zuvor und beendete die Diskussion: »Gut, nummerieren wir sie durch: Verdächtiger 1 für unseren Tausendsassa Victor Pais, V2 für Bruno Melo, Verdächtiger 3 für den Mann, zu dem er uns hoffentlich führen wird.«
Carlos wusste, sie tat es nicht aus Einsicht (vielleicht ein klitzekleines bisschen), sondern aus Pragmatismus. Für Graciana war nicht kriegsentscheidend, mit welchen Etiketten diese Männer durch den Funk geisterten. Sie wollte sie festnageln.
Carlos Esteves leerte das Super-Bock und legte ein paar Münzen auf die dafür vorgesehene Metallschale, bevor er aufstand. Er gab großzügig Trinkgeld. Schon als Teenager hatte er das getan, sein Vater hatte ihn das gelehrt.
Sparsamkeit ist nichts Schlechtes, aber sie sollte einen selbst begrenzen, nicht andere.
Und auch später, als es unter den jungen Leuten modern wurde, Geiz für etwas Gutes zu halten, weil es ihnen die Werbung eintrichterte, hielt er als alter Mann dagegen.
Geiz ist eine moralische Verkrüppelung, hatte er gesagt.
Und weil Carlos sich an diesen Moment mit seinem alten Herrn gerade erinnerte, ein Augenblick aus vergangenen Tagen, der ihm das Herz wärmte, legte er noch einen Euro drauf. Er hätte sein ganzes Hab und Gut für eine halbe Stunde mit seinem Vater gegeben.
Dann schlenderte er dem Tausendsassa und dem V2 hinterher.
»Ich bin hinter ihnen«, sprach er leise in seinen Hemdkragen und kürzte den Straßennamen der Avenida 25 de Abril absichtlich ab, um Lost zu necken: »Sie gehen auf der Abril Richtung Kanal.«
»Avenida 25 de Abril?«, kam es prompt über das Intercom.
Esteves musste schmunzeln. »Es gibt nur eine Straße mit Abril in Fuseta«, ließ er ihn sanft abtropfen.
Der Tausendsassa und V2 gingen keine zwanzig Meter weit, während derer Bruno Melo die Umgebung misstrauisch beäugte, bis sie einen Wagen erreichten.
Esteves sah es an der Art, wie der Mann stoppte. Er ahnte die Drehung, er ahnte den Blick über die Schulter, die dem gesamten Straßenabschnitt hinter Melo gelten würde. Also jenem, in dem er, Carlos, sich befand.
Gerade rechtzeitig zauberte er aus den Untiefen seiner Jacketttasche eine Selbstgedrehte hervor und beugte sich zu einem Mann, der ihm rauchend entgegenkam: »Tem luz, por favor?«
Der Mann nickte und zückte exakt in dem Augenblick das Feuerzeug, in dem Melos Blick sie beide traf. Die Flamme entsprang direkt vor Carlos’ Gesicht, und er zog an seiner Zigarette, deren Spitze hellorange aufglomm.
Er nickte dem Passanten dankend zu und setzte seinen Weg fort. Im Vorbeigehen prägte er sich das Nummernschild des Autos ein, in das Bruno Melo und Victor Pais gerade stiegen. Als er sicher war, dass die beiden die Türen geschlossen hatten und ihn nicht hören konnten, gab er die Information weiter: »V1 und V2 sind in einen silbernen Renault Captur gestiegen. Wenn sie nicht wenden, fahren sie Richtung Kanal. Das Kennzeichen ist 23–24-JK.«
»Ich übernehme«, meldete sich Sub-Inspektorin Graciana Rosado zu Wort. Mit ihren 1,62 Metern Körpergröße hatte sie den Sitz des Mustang ganz nach vorne geschoben. Ihre Füße steckten in flachen Schuhen, mit denen sie einen Sprint hinlegen konnte. Das war auch der Grund, weshalb sie sich heute Abend für einen Rock entschieden hatte. Darüber eine olivfarbene Bluse und eine passende beige Jacke, die die Glock 26, die Dienstwaffe für Frauen, geschickt vor neugierigen Blicken verbarg.
Das schulterlange Haar war zu einem Zopf zusammengefasst, der Pony reichte bis zu den Brauen. In ihrem ebenmäßigen Gesicht dominierten die ernsten Augen.
Graciana weckte den V8-Motor des Mustang mit einem Druck auf den Startknopf, dann erwachte das Biest mit einem Vibrieren, das durchs ganze Fahrzeug lief. »Senhor Lost, warten Sie mit dem Motorrad bei Madeira & Madeira«, wies sie den Alemão an, während sie ausscherte.
»Verstanden«, kam es knapp zurück.
Sie bog nach rechts ab, tippte das Gaspedal nur kurz an und der Wagen vollzog einen brummigen Satz. Schon lenkte sie ihn geschickt durch den Kreisverkehr – und sah den Renault nur 30 Meter vor ihr.
Sicherheitshalber wandte sie sich per Intercom an den einzigen in Spanien geborenen Sub-Inspektor im Team: »Miguel, falls er Spielchen mit mir spielt, postier dich vorsichtshalber an der Ponte Grande.«
»Und was ist, wenn er auf der N 125 wegzieht? Wenn ich doch meinen Jaguar benutzen könnte …«
»Mit der Vespa kannst du durch die Fußgängerzonen abkürzen. Hatten wir das nicht schon?«
Duarte gab sich keine Mühe, sein Seufzen zu unterdrücken. Kaum war der kleinen Sub-Inspektorin das letzte Wort über die Lippen gekommen, bremste der Renault stark ab und legte eine Kehrtwendung hin, um in entgegengesetzter Richtung an ihr vorbeizuschießen.
»Merda.«
»Was ist?«
Das war Carlos’ Stimme.
»Er hat mich verladen, er fährt wieder zurück.«
»Nach Westen?«
Das war Lost.
»Sim. Ich kann nicht wenden, zu auffällig.«
Bruno Melo und der Tausendsassa durften ihnen auf gar keinen Fall von der Leine gehen. Denn die beiden würden sie zu einem weit größeren Fisch führen: V3. Einer, der sich an den Tausendsassa gewandt hatte, um sich diskret mit ihm zu treffen. Es würde so schnell kein weiteres Treffen geben. Graciana Rosado wusste: Ihre Chance war genau heute. Jetzt.
»Besonders weit sind wir jetzt noch nicht gekommen«, merkte Victor Pais, der Tausendsassa, auf dem Beifahrersitz des Renault zu diesem Zeitpunkt an. Bruno Melo reagierte darauf nicht mal mit einem Blick. Er sah sich immer noch unermüdlich in alle Richtungen um.
Pais zog zwei Zigaretten aus seiner Brusttasche und hielt Melo eine hin.
Der schüttelte den Kopf: »Nichtraucherwagen.«
Pais seufzte und stopfte sie wieder zurück.
Als der Renault die N 125 erreichte, die von der spanischen Grenze quer durch die Algarve bis an den westlichsten Punkt des europäischen Festlands führte, bog Melo nach links ab.
Lost gab ihnen zweihundert Meter Vorsprung, dann startete er die Ducati Scrambler und folgte dem Renault Captur in einigem Abstand. Per Intercom übermittelte er die Fahrtrichtung, die aktuelle Position und die Geschwindigkeit.
Pais, der gelangweilt einen Blick in den Außenspiegel warf, sah die schwarze Figur auf der gelben Retromaschine, die kurz im Licht einer Laterne auftauchte. Eine dünne Gestalt in einem schwarzen Anzug mit einer im Fahrtwind flatternden Krawatte. Schwarzer Helm, schwarzes Visier.
Er deutete mit dem kurzen Vorschieben des Kinns auf den Motorradfahrer hinter ihnen und sagte: »Da folgt uns einer im Anzug. Auf dem Motorrad.«
Melo nickte zuerst und schüttelte dann den Kopf. Beides mit minimalem Aufwand.
Victor Pais war dieses Maß an Gesprächigkeit gerade recht. Er konnte es gut leiden, wenn jemand mit seinen Worten zu haushalten wusste.
»Schon gesehen. Ist kein Bulle. Viel zu auffällig mit dem behämmerten Anzug bei der Hitze.«
Als Bruno Melo die nächste Linksabbiegerspur zurück nach Fuseta nahm, rauschte der Mann im schwarzen Anzug einfach auf der N 125 weiter.
Der Renault ging Miguel Duarte keine Minute später ins Netz, der den Wagen bis zur Rua do Paiol verfolgte, wo Melo ihn parkte und die beiden Männer ausstiegen.
Graciana Rosado hatte den Mustang unten an der Promenade abgestellt, keine hundert Meter entfernt, und schloss mit zügigen, aber unauffälligen Schritten zu Carlos Esteves auf, der neben einer Parkbank an dem Platz wartete, in den die Rua do Paiol mündete. Von hier aus konnte er die Umrisse von V1 und V2 sehen. Er selbst fiel unter dem guten Dutzend Leuten, die hier was tranken und sich über die Vor- und Nachteile von Benfica Lissabon und dem FC Porto unterhielten, nicht auf. Er musste eher aufpassen, sich nicht in die Diskussion darüber hineinziehen zu lassen, ob nun Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi der bessere Fußballer sei – was gar nicht so einfach war, weil die Antwort darauf doch kristallklar auf der Hand lag. War Wasser nass?
»Ronaldo ist doch gar kein richtiger Fußballer, er kann nur Tore machen«, sagte ein junger Kerl mit Dreadlocks.
Esteves platzte der Kragen: »Es gibt Fußballer, die machen gar keine Tore. Sind das richtige Fußballer? Ist doch für einen Fußballer nicht schlecht, Tore zu schießen.«
Der Dreadlocks-Mann und seine beiden Begleiter schauten auf und kamen nun näher. Sie musterten Carlos wie ein fleischgewordenes Ärgernis. »Lionel spielt auf allen drei Stürmerpositionen, und er dribbelt die Verteidiger aus.«
»Ach so, und Ronaldo bekommt immer eine Luftbrücke über die Verteidigung spendiert, oder wie kommt der an denen vorbei?«
»Ach, herrje, ein Ronaldo-Jünger. Messi ist auf dem Markt viel mehr wert. Schon mal darüber nachgedacht, ja?«
»Und? Ronaldo hat mehr Tore geschossen. Vielleicht«, er grinste, »kann Messi ja die hübscheren Einwürfe?«
»Hey, pass mal auf.«
Der mit den Dreadlocks kam näher, die Lippen zu einer Linie aufeinandergepresst.
Graciana, die soeben Leander Lost hierher zurückbeordert hatte, erreichte Carlos. »Sag mal, spinnst du?«
»Die reden schlecht über Cristiano Ronaldo.«
Sie beugte sich zu ihm vor: »Wir sind mitten in der Observierung!«
»Ja, ja, ich weiß – aber sie haben schlecht über Ronaldo geredet.«
Graciana seufzte und zog Carlos mit sich zur Seite. »Wo ist Duarte?«
»Er sichert die Straße nach hinten ab«, gab Esteves zur Antwort und riskierte einen Blick auf die beiden Männer, die nun Pais’ Werkstatt erreicht hatten – und darin verschwanden.
»V1 und V2 sind zurück in der Werkstatt«, flüsterte Graciana über Funk an Duarte und Lost gerichtet. Gleichzeitig zog Carlos Esteves ein iPad aus der Innentasche seines Jacketts und rief ein Programm auf, das sich zunächst in drei Fenster gliederte. Ein großes, das den halben Bildschirm einnahm, darunter zwei, die sich den restlichen Platz hälftig teilten.
»Olá, du musst Vic sein, der Tausendsassa«, hörten sie, jetzt aber begleitet von einem leichten Funkrauschen.
»Vic reicht.«
In diesem Augenblick füllten sich die Fenster auf Esteves’ Tablet mit Videoaufnahmen. Die ersten beiden zeigten die Werkstatt aus zwei Perspektiven, eine in Hüfthöhe (sie hatten die Überwachungskamera im Hohlraum einer Holzskulptur versteckt), die andere von oben (im Gehäuse des Deckenventilators). Und sie übertrugen auch den Ton. Die dritte Kamera steckte in einer Keksdose und lieferte durch das winzige Loch, das die Kriminaltechnikerin noch gestern Abend in den Behälter gebohrt hatte, eine Übersicht über die Wohnung im ersten Stock, in der sich momentan niemand befand.
Carlos und Graciana schauten auf das Bild mit den drei Männern in der Werkstatt. Während Bruno Melo an der Eingangstür stehen blieb, trat ein durchschnittlich großer Mann mit kahl geschorenem Schädel an Victor Pais heran und reichte ihm die Hand, die er schüttelte.
»Volltreffer: V3«, sagte Carlos mit gesenkter Stimme, als könne ihre Überwachung auffliegen, wenn er zu laut sprach.
»Ja«, bestätigte Graciana und fügte für Leander Lost und Miguel Duarte hinzu: »Es ist Diogo Serra.«
Bruno Melo hatte den ganzen Aufwand also nur getrieben, um mögliche Verfolger aus der Rua do Paiol zu locken, damit sein Chef, Diogo Serra, V3, unbehelligt die Werkstatt des Tausendsassas betreten konnte.
Des Tausendsassas Victor »Vic« Pais. Der die Kameras zu seiner eigenen Sicherheit wollte und der Bruno Melo absichtlich auf den Motorradfahrer aufmerksam gemacht hatte, um zu testen, ob das Sicherheitsnetz lückenlos funktionierte.
Das Sicherheitsnetz, das diese kleine, energische Sub-Inspektorin ihm vor rund 10 Tagen als seine Lebensversicherung versprochen und nun feinmaschig gespannt hatte.
2. Kapitel
Ihm war eigentlich nur ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Nicht mal das, es war bei Licht betrachtet eher eine Unachtsamkeit. Ein Detail, das anderen verborgen geblieben wäre. Selbst versierten Hackern.
Aber die Polícia Judiciária in Faro verfügte wohl über eine Kriminaltechnikerin, die auf Zack war. Unerbittlich wie ein Hai, der auf mehrere Kilometer einen Tropfen Blut gewittert hatte, machte sie sich auf den Weg durch vernetzte Server und Cloudspeicher, klapperte IP-Adressen ab und sammelte im Darknet seine Spuren. Bits und Bytes, verschlüsselte digitale Rudimente. Nichts, was separat betrachtet auf ihn verwiesen hätte. Er war schließlich kein Einfaltspinsel.
Aber nun hatte sich gerächt, womit seine Mutter ihm bis zu dem Tag seines Auszugs in den Ohren gelegen hatte: dass er hinter sich nicht aufräumte. Bloß war das im Darknet ungleich gefährlicher.
Die Kriminaltechnikerin hatte ihre kleinen Fundstücke mit der unerbittlichen Akribie einer Maschine zu einer Spur zusammengesetzt, zu Eigenschaften, und die führten sie zu ihm. Aber sie schlug nicht voreilig zu, sondern wartete ab.
Wartete darauf, dass er es wieder tat.
Und Victor Pais, der Tausendsassa, der ganz ohne Drogen völlig high war von dem, was er da seit über 24 Stunden tat und dabei aus dem Grinsen nicht mehr herauskam und manchmal wie ein kleiner Junge kichern musste und sich ein anderes Mal vor Lachen am Boden krümmte, weil er kaum noch Luft bekam, tat es wieder.
Und dann griffen sie zu. Ganz routiniert.
Oben bei Alfandanga sprang die Ampel auf Rot. Er stoppte. Zwei Fahrzeuge schossen aus dem Nichts heran und versperrten ihm den Weg nach vorne und nach hinten, und bevor er den nächsten Atemzug tat, lag er schon bäuchlings auf dem warmen Asphalt der N 125. Um keine halbe Minute später in Handschellen auf der Rückbank eines der beiden Autos auf dem Weg nach Faro zu sitzen.
Dort sah der Tausendsassa sie bei seiner Vernehmung in den Räumen des Kommissariats zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht: eine Frau mit schweren Boots, einer Armeehose in Tarnfarben und kurz geschorenen Haaren. Sie erinnerte ihn an Sinéad O’Connor und sie musterte ihn mit unverhohlener Neugier. In ihren Augen lag dieselbe Belustigung, als hätte sie ihn als Kind mit der Hand im Marmeladenglas erwischt. Sie war in seinem Alter, Mitte dreißig. Ihr Name war Isadora Jordão. Die Kriminaltechnikerin der Polícia Judiciária von Faro.
»Wir wissen, dass Sie mit Kleinigkeiten hehlen«, hatte die SubInspektorin Graciana Rosado gesagt. »Uma Bica?«
Er nickte.
»Noch jemand?«, fragte ihr Kollege Carlos Esteves.
Niemand meldete sich, also stand er erstaunlich leichtfüßig auf und ließ an der Kaffeemaschine zwei Bica raus – eine für sich selbst.
Das mit dem Hehlen stimmte. Aber in Pais’ Ohren klang das wenig schmeichelhaft.
»Das klingt nicht sehr nett«, sagte er deshalb.
»Ist das der Grund, warum Sie sich Tausendsassa nennen?«
Das fragte der Mann im schwarzen Anzug, der keine Miene verzog und an der Seite des Tisches saß.
»Andere nennen mich so.«
»Warum?«
»Vermutlich, weil er alles besorgen kann, wonach man ihn fragt«, antwortete Graciana Rosado an seiner Stelle.
Victor Pais nickte und versuchte, sich den Stolz über diesen Beinamen nicht anmerken zu lassen. Hin und wieder verlor jemand etwas, ein Tourist ein Smartphone, eine Telefonkarte, eine Kette, einen Geldschein, solche Dinge, und ja, es gab sogar Leute, denen ein ganzes Auto abhandenkam. Und er, Vic, brachte wie ein Fundbüro Gegenstände und Leute zusammen, wobei die Leute nicht die Besitzer waren, sondern Interessenten.
»Es heißt, es gibt nichts, was Sie nicht besorgen können«, stellte Carlos Esteves fest und stellte die Bica samt Zuckertütchen und kleinem Löffel vor ihm ab.
»Obrigado.«
»De nada«, sagte der große Kerl und nahm wieder Platz.
Victor Pais maß einen gestrichenen Löffel ab und rührte ihn in der Bica um – der frische Duft von gemahlenen Kaffeebohnen stieg ihm in die Nase, und unwillkürlich weitete er die Nasenlöcher, um das Aroma zu genießen. Hervorragender Säuregrad.
»Ja, das sagt man«, bestätigte er und fühlte sich geschmeichelt, »aber ich besorge zum Beispiel keine Waffen. Keine Drogen.«
Er hatte schließlich seine Prinzipien.
Isadora Jordão, Esteves und die Sub-Inspektorin Rosado schauten daraufhin unisono zu Leander Lost.
»Ist das wahr?«, fragte Graciana ihn, da er nicht von sich aus auf ihre Blicke reagierte.
»Ja.«
Danach wandten sie sich wieder an den Tausendsassa. Der hatte den Eindruck, die drei nahmen die Aussage des Mannes für bare Münze. »Ist das Ihr Lügendetektor?«, fragte er und konnte sich ein kleines Grinsen wegen seines Scherzes nicht verkneifen.
»So ist es«, bestätigte Carlos Esteves ihm ungerührt, woraufhin sein Lächeln erst hölzern wurde und dann erstarb.
Victor Pais sah zu dem Mann im schwarzen Anzug, der ihn seinerseits aufmerksam musterte.
»Ich habe eine Ex-Freundin in Lagos.«
Das war gelogen. Aber es war eine Lüge mit Ankündigung, denn noch zweifelte Victor Pais an Losts Fähigkeit – zumindest an deren Unfehlbarkeit. Und es juckte ihn in den Fingern, den Mann zu täuschen. Aus sportlichem Ehrgeiz.
Bei jedem Menschen, der log, das wusste Leander Lost, spiegelte sich in dessen Mimik Angst, Schuld oder Freude. Die Angst, ertappt zu werden, die Schuld durch ein schlechtes Gewissen oder die Freude an der gelungenen Irreführung. Manchmal war es auch eine Kombination aus zwei oder allen drei Emotionen.
Dann konnte die Deutung komplex werden.
Angst konnte Leander im Gesichtsausdruck von Victor Pais so wenig erkennen wie Schuld. Aber er registrierte die mimischen Merkmale unterdrückter Freude: die zusammengepressten Lippen und die leicht heruntergezogenen Mundwinkel, die ein verräterisches Grinsen unterdrücken sollten.
Dem Alemão war das beiläufige Lesen, die intuitive Deutung menschlicher Mimik fremd. Er musste sie in jedem Augenblick neu decodieren. Dabei half ihm die Auflistung aller emotionalen Gesichtsausdrücke, die der Psychologe Paul Ekman zusammengestellt hatte. Lost hatte sie alle in seinem Gedächtnis gespeichert. Und immerhin war in 46 Gesichtsmuskeln eine Bildung von rund 10.000 Ausdrücken möglich.
»Nein«, urteilte er in Bezug auf Pais’ Aussage über seine angebliche Ex-Freundin in Lagos.
»Ich hab meinem Vater mit 10 Jahren 20 Euro aus der Brief tasche gestohlen.«
»Nein.«
Die Freude in Pais’ Gesicht nahm nun langsam ab und wich echter Überraschung: Kinnlade locker, Mund und Augen weit geöffnet. Echt war sie, weil sie nicht länger als eine Sekunde an dauerte. Sonst wäre sie vorgetäuscht gewesen (Lost hatte diesen Gesichtsausdruck oft bei Menschen studieren können, wenn sie ein Geschenk auspackten).
»30 Euro mit 12.«
»Nein.«
»10 Euro mit 11.«
»Ja.«
Victor Pais hatte seine Reaktionen üblicherweise gut im Griff.
Das betrachtete er nicht nur von Berufs wegen als Vorteil, sondern es erschien ihm ganz allgemein geboten, nicht mit offenen Karten durchs Leben zu laufen. Trotzdem war es ihm in diesem Augenblick unmöglich, seine Verblüffung zu verbergen. Dafür war das Potenzial der Gabe, über die dieser Mann mit dem Pokerface anscheinend verfügte, zu groß. Zu groß, um es sich nicht ebenfalls anzueignen.
»Wie machen Sie das?«
»Ich lese es in Ihrer Mimik«, bekam er zur Antwort.
»Aha. Und ... «
»Und«, unterbrach Graciana Rosado ihn ruhig, beinahe sanft, »deshalb von unserer Seite folgendes Angebot: Wir haben in Ihrer Wohnung und Werkstatt diverses Diebesgut sichergestellt. Das reicht für eine Freiheitsstrafe, auch wenn Sie bis jetzt noch nie verurteilt worden sind. Ich möchte den hier.«
Sie legte drei Fotografien auf den Tisch.
Im 21. Jahrhundert bestanden die Observierungsfotos nicht mehr aus grobkörnigen, verwischten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, sondern aus gestochen scharfen Farbfotos. Alle drei zeigten Diogo Serra. Einmal telefonierend an seinem Auto, einmal mit einem Begleiter in einer Fußgängerzone in Tavira und schließlich an Bord einer kleinen Jacht. Freier Oberkörper, Sonnenbrille – plus ein paar Freunde.
»Sie packen aus, wie Serras System funktioniert und warum Sie ihn bestehlen, und dann stellen wir ihm eine Falle. Mit Ihnen.«
»Mit mir?«
»Sind Sie ein Echo?«
Pais seufzte: »Und was soll ich dabei machen?«
»Sie sind der Köder.«
»Und danach? Wenn alles gelaufen ist?«
»Dann kriegen Sie Bewährung. Ich habe mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Wenn Sie kooperieren, machen die den Deal.«
Victor Pais schluckte leer.
Esteves deutete mit einer Kopfbewegung auf Leander Lost: »Wenn Sie lügen, gibt es keine Bewährung.«
Die Kommissarin mit dem Pferdeschwanz nickte.
Pais suchte wieder den Blickkontakt mit dem Alemão, der immer noch mit unbewegter Miene dort saß.
»Schön«, lenkte er deshalb ein, »was wollen Sie wissen?«
»Wir wissen«, richtete Isadora Jordão das Wort an ihn, »dass Sie Diogo Serras Geschäfte torpediert haben. Wie?«
Ein letztes Zögern noch, dann atmete Victor Pais tief durch.
»Zufall«, antwortete er und war ab jetzt ein Informant der Polícia Judiciária.
Leander Lost nickte – die erste Antwort entsprach der Wahrheit. So wie alle folgenden auch.
Es war, wie er erzählte, einer Verwechslung zu verdanken. Als Victor Pais ein Päckchen mit im Internet bestellten Dingen aus einer Packstation in Faro abholen wollte, lag in seinem Fach ein Päckchen mit Crystal Meth, das nicht an ihn adressiert war – offenbar hatte der Paketdienst zwei Lieferungen miteinander vertauscht.
Über diese Lieferung stieß Pais im Darknet auf einen Shop, in dem man Drogen ordern und sie mit Bitcoins bezahlen konnte. Einmal im System drin, war es dem Tausendsassa ein Leichtes, nach und nach das ganze Netz aufzudecken: Diogo Serra betrieb einen Rauschgifthandel, dessen Reichweite und Umsatz sich nahezu alle zehn Tage verdoppelte. Dabei bediente er sich eines Verteilernetzes, das ihn ebenso unwissentlich wie diskret unterstützte: die portugiesische Post. Sie trug seine Lieferungen zuverlässig in die entlegensten Winkel.
Bis Victor Pais dazwischenfunkte.
»Bis dahin war Senhor Serra Sender und Empfänger«, erklärte er den Inspektoren, »er hat die Päckchen versendet und das Geld empfangen. Und dann habe ich ihn als Empfänger ersetzt. Das heißt, er hat weiterhin die bestellten Drogen versandt, aber ich habe die Bitcoins umgeleitet. Auf mein Konto im Darknet.«
»Und da ist das Geld jetzt?«, wollte Graciana Rosado wissen.
»Nein, ich hab’s gespendet.«
Die Blicke gingen unisono zu Lost, der nickte.
»Sie haben das Geld gespendet?«, hakte Esteves erstaunt nach.
»Ja.«
»An wen?«
»Ärzte ohne Grenzen, UNICEF, Greenpeace, ein paar Hospize und noch ein paar andere, die’s gebrauchen können. Kann ich alles belegen. Bis auf den Cent. Das stimmt, richtig, Senhor ... «
»Lost«, half Isadora aus.
»Ja, das ist wahr«, bestätigte Leander Lost.
Das war es, was Victor Pais so zum Lachen gebracht hatte – Diogo Serra verschickte seine Drogen und Pais brachte ihn um seine Bezahlung. Innerhalb jener 24 Stunden, die ihm einen Heidenspaß bereitet hatten, erleichterte er Serra um knapp 80.000 Euro. Und die Kirsche auf der Torte: Serra konnte den Betrug an ihm nicht mal bei der Polizei melden.
An die abrupt einsetzende Unehrlichkeit seiner Kunden glaubte Diogo Serra nicht. Er hatte eine schillernde Reihe an Jobs durchlaufen: Türsteher, Inkasso-Eintreiber, Security-Mann und einiges mehr. Aber er war nicht dumm. Ganz im Gegenteil. Er verfügte über eine gute Menschenkenntnis.
Diogo hatte erfasst, dass eine neue Zeit angebrochen war, in der man nicht mehr mit einem Revolver in eine Bank ging, um zehntausend Euro zu erbeuten, sondern dass die lohnenden Raubzüge heute per Tastatur und Internetanschluss erledigt wurden.
Nach dem Verlust der 80.000 Euro war ihm schnell klar: Er war im Darknet gehackt worden. Jemand, dem er alle Knochen brechen würde (nicht alle auf einmal, sondern nach und nach, sie sollten ja beide was davon haben), hatte viel Geld mit ihm verdient. Geld, das ihm gehörte. Geld, das er zurückhaben wollte.
»Diogo Serra«, erläuterte Graciana Rosado dem Tausendsassa, »sucht schon nach jemandem, der diese Schwachstelle in seinem Verteilersystem schnellstmöglich flicken kann.«
»Woher wissen Sie das?«
»Wir haben Informationen aus der Szene«, hielt die Sub-Inspektorin sich bedeckt, »und wir werden den Hinweis streuen, dass es da jemanden gibt: Sie.«
»Sie lenken die Zahlungen wieder auf sein Konto um«, führte Isadora Jordão aus, »mir ist klar, dass Sie dazu nur eine Programmzeile ändern müssen, das kostet Sie keine halbe Minute. Aber Sie tun so, als würde das länger dauern. Bauschen Sie den Aufwand ruhig schön auf. Sie verdienen sich sein Vertrauen. Sie sagen ihm, dass Sie noch ein paar Informationen mehr benötigen, damit sein Geschäft im Darknet auch in Zukunft unangreifbar bleibt.«
»Und wenn er das nicht will?«
»Er will«, versicherte Carlos ihm, »weil er durch Ihren Eingriff sofort wieder Geld sieht.«
Pais nickte. An dem Plan war nichts auszusetzen. Es würde vermutlich haargenau so funktionieren, wie die Truppe hier sich das ausgedacht hatte.
Mit einem Haken: »Und dann nehmen Sie Serra hoch, und er weiß, dass ich für Sie gearbeitet habe.«
Graciana deutete ein Kopfschütteln an: »Wenn wir zugreifen, sind Sie schon lange aus dem Spiel. Uns geht es nicht um das System von Senhor Serra, zumindest nicht primär. Uns interessiert, von wem er die Drogen bekommt. Und wenn Sie ihm helfen, sein Vertriebsnetz abzusichern, erfahren Sie das früher oder später und erzählen es uns. Danach können Sie gehen.«
»Meine Polizeiakte ist dann ohne jeden Eintrag?«
»Genau«, bestätigte Carlos Esteves ihm.
Pais’ Gesichtsausdruck war für Leander Lost nicht einfach zu entschlüsseln, denn der bestand in einer komplexen Kombination aus Anerkennung, Zustimmung, einer Prise Vergnügen, einem Hauch Sorge, etwas Genugtuung und nicht zuletzt aus einer Art ... Lust am Risiko.
»Ich bin dabei«, sagte der Tausendsassa.
»Worin bestand Ihre ursprüngliche Motivation, das Verteilernetz von Senhor Serra zu hacken?«, fragte Leander und beobachtete, wie sich die Innenseiten der Augenbrauen anhoben und Victor Pais die Unterlippe nach oben schob (was ein Ab senken der Mundwinkel zur Folge hatte). Es war ein trauriger Gesichtsausdruck, der überall auf der Welt derselbe war – die Mimik lag in den Genen.
Da Victor Pais nun auch langsamer und von der Tonlage her tiefer sprach, war Lost sich sicher, dass der Mann die leichte Form von Trauer empfand: Bedauern.
»Er hat mir mal meine Freundin ausgespannt.«
»Wann war das?«, fragte Graciana Rosado sofort, weil dieser Umstand für ihre Planung hinderlich sein konnte.
»Wir waren neun«, hatte der Tausendsassa geantwortet und in ihre irritierten Mienen gegrinst: »Ich bin eben nachtragend.«
3. Kapitel
»Ich hab’s nicht gerne, wenn sich hier jemand Zutritt verschafft«, sagte Pais mit einem freundlichen Lächeln, und Diogo Serra nickte, als unterschreibe er diese Aussage tagein, tagaus und als bekümmere es ihn ebenso sehr wie Pais, dass sich offenbar niemand darum scherte.
»Natürlich«, stimmte er ihm zu, »ich mag ... das selbst nicht gerne. Aber ich musste sichergehen.«
Über ihre Intercoms und das Tablet hörten und sahen Graciana, Carlos und Leander Lost, was im Inneren des Gebäudes vor sich ging.
Sie hatten sich der Adresse zu dritt genähert und postierten sich in dem offenen Durchgang schräg gegenüber.
»Ich hab von Leuten gehört, du kannst mein Problem lösen.«
»Das hab ich schon.«
»Wie war das?«
»Es ist so, dass das Geld jetzt nicht mehr woanders landet.«
Während Victor Pais dem Mann erklärte, dass er dessen Leck notdürftig geflickt hatte und es allerdings noch einiger Bemühungen bedurfte, es auch gegen zukünftige, noch raffiniertere Attacken zu wappnen, stieß Miguel Duarte zu ihnen.
Er trug einen hellbraunen Anzug, ein braunes Hemd, braune italienische Slipper. Die Sonnenbrille baumelte am obersten Hemdknopf. Einhändig zog er sich mit einem kleinen Kamm den Scheitel nach.
»Und?«, erkundigte er sich.
»Läuft«, ließ Carlos ihn wissen.
Duarte brummte etwas, was in etwa die Bedeutung von »aha« hatte. Dann schaute er in den Sternenhimmel und fuhr mit seinem Daumen erst nach links über seinen schmalen Schnurrbart, dann nach rechts. Hüstelte. Zupfte einen Fussel von seinem Ärmel und unterdrückte dann halbwegs ein Gähnen.
Er verstand nicht, woher die drei die Leidenschaft nahmen, mit der sie auf dem Tablet verfolgten, wie sich drei kleine Fische miteinander unterhielten.
»Mit was hehlt dieser Pais so? Zigaretten? Smartphones?«
»Smartphones sind korrekt«, bestätigte Leander ihm.
»Wow. Da habt ihr ja einen dicken Fisch an der Angel.«
»Er ist der Köder. Der Fisch sitzt in Lissabon«, erwiderte Graciana ruhig und löste dabei nicht den Blick von dem iPad.
Natürlich: Lissabon.
Der, der die Drogen an diesen Diogo Serra und andere verteilte, saß nicht hier, kein Wunder, was hätte er hier auch tun sollen: Einsiedlerkrebse zählen? Oder sich das Seemannsgarn von ein paar Garnelenfischern anhören vielleicht? Was könnte er denn hier abends schon machen?
Duarte selbst hatte wenigstens ein Apartment in Faro (mit Blick auf die Marina und einen Tiefgaragenstellplatz für sein Jaguar-Cabrio, damit der Lack und die Lederbezüge nicht ständig der salzigen Meeresluft ausgesetzt waren). Mit einer Gourmet-Küchenzeile, so sündhaft teuer, dass er stattdessen auswärts aß oder sich was liefern ließ, um das gute Stück zu schonen. Alles eifrig angespart – von der Apanage, die seine Mutter ihm diskret an seinem Vater vorbei in unregelmäßigen Abständen zukommen ließ.
Aber seine Vorgesetzte Graciana Rosado und der Kollege Carlos Esteves wohnten hier in Fuseta, in diesem Dorf mit knapp über zweitausend Einwohnern. Ohne Theater, Kino oder Oper: kulturelles Brachland. Ohne ein Hotel, ohne ein erstklassiges Restaurant, ja, man konnte wohl von Glück sagen, dass man nicht noch vergessen hatte, dieser Ansammlung von Häusern einen Namen zu geben.
Sie würden bis zu ihrer Rente hier wohnen und ihr Leben verpassen. Und danach beim Anblick von Wellen oder Möwen oder so über Jahre wegdämmern.
Für Miguel Duarte war das eine grauenhafte Vorstellung. Seine Bestimmung lag fraglos in der Hauptstadt.
»Er hat einen Koffer dabei«, stellte Carlos fest, als Diogo Serra einen kleinen Reisekoffer auf den Tisch legte und ihn öffnete.
»Das ist ja allerhand«, sagte Duarte, »ein Koffer.«
»Ich weiß«, meinte Graciana und kräuselte dabei die Stirn, »dir ist das alles zu klein-klein, Miguel. Aber ich möchte hören, was er sagt. Danke.«
Pais sah einige fein säuberlich portionierte Päckchen in dem Koffer.
»Kokain?«, fragte er und bemühte sich um einen gelassenen, mäßig interessierten Ton.
»Auch. Crack, Crystal Meth, Ecstacy«, antwortete Serra sachlich.
Der Tausendsassa nickte zwar, aber er tat es nur, um sein Stutzen zu überspielen.
In dem Plan der PJ kamen nämlich keine Drogen vor. Und es machte auch keinen Sinn (und verdoppelte seine Irritation), mit dem Crack hier aufzutauchen, wenn man sich damit eben gerade nicht erwischen lassen wollte und die Drogen deshalb über anonyme Packstationsfächer vertickte. Ihm kam es vor wie ein kleiner falscher Ton in einer ansonsten runden Melodie. Eine klitzekleine Anomalie.
Diogo Serra grinste kurz, als er bemerkte, dass Victor Pais sich keinen Reim auf den Kofferinhalt machen konnte. Er klopfte sanft mit der flachen Hand auf die Päckchen.
»Ich bezahl dich nicht einmalig, sondern fortlaufend. Das hier ist genug Zeug, um die Anfragen in den nächsten vier Wochen zu bedienen«, erklärte Serra und trat nun nah an Pais heran: »Du sorgst dafür, dass das Geld nicht irgendwo abgegriffen wird, und verschickst die Lieferungen. Dafür bekommst du zehn Prozent.«
»Für das Verschicken?«
»Genau.«
»Das ... ist nicht wenig.«
»Ja«, stimmte Diogo Serra ihm zu, »zehn Prozent davon sind gut 15.000 Euro. Dafür darf dir aber nichts verloren gehen. Oder, anders gesagt: Wenn dein System auch gehackt wird, kommst du für die Ware auf. Wenn du also ein bombensicheres Programm geschrieben hast, wie du sagst, dann kannst du mit wenig Aufwand viel Kohle machen.«
»Das ... muss ich mir kurz überlegen.«
»Klar. Mach ruhig. Aber nicht ewig, ich hab noch was vor: zwei Minuten.«
»Sieh an, unser Rentner«, sagte Carlos. Graciana, Leander und Duarte folgten seinem Blick und sahen ihn nun auch: die kleine, korpulente Gestalt von Luís Dias, der die Straße hochkam.
Dias hatte bis vor Kurzem noch für die Guarda Nacional Republicana, kurz GNR, gearbeitet. Die Polizeieinheit war der Kriminalpolizei unterstellt und kümmerte sich um Naheliegendes: Ruhestörungen, Verkehrskontrollen, entlaufene Hunde, Ehestreitigkeiten und dergleichen mehr. Das Revier hier in der Gegend lag ein paar Kilometer nördlich von Fuseta in Moncarapacho.
Dort hatte Luís Dias in seiner Dienstzeit rekordverdächtige 72.451 Solitär-Spiele auf dem Computer absolviert. Viele körperliche Handicaps wie Magenverstimmung (264 Mal), plötzliches Unwohlsein (1.106 Mal) und grippaler Infekt (697 Mal) hatten ihn ans heimische Bett gefesselt. Dort hing zur Linderung seines Siechtums ein Breitbildfernseher, auf dem er – auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod wandelnd – wenigstens ein paar Fußballspiele hatte verfolgen können.
Auf seinen Präsenzgängen durch den Ort schnitt er manchmal vor Touristinnen auf (bevorzugt vor blonden) und vermied jede Menge Papierkram, indem er angesichts von Verkehrs- und anderen kleineren Delikten beide Augen fest zudrückte. Und wenn daraufhin noch ein praktisch gefalteter Euroschein in seine Brusttasche wehte, empfand er tiefen Frieden.
Über Jahrzehnte bei der GNR hatte er sich auf sein Rentnerdasein akribisch vorbereitet, indem er jegliche Aufregung vermied.
Und genau dieser Luís Dias öffnete jetzt plötzlich die Tür zur Werkstatt des Tausendsassas.
Graciana, Carlos, Leander und Miguel Duarte waren im ersten Augenblick viel zu verblüfft über dieses Manöver, sodass sie nur weiter auf das iPad starrten.
»Merda.«
»Was soll das?«
Das Tablet präsentierte ihnen die Antwort auf diese Frage: Luís Dias riss eine Glock 25 aus dem Hosenbund, die von seiner Jacke verdeckt worden war, und richtete sie auf Victor Pais, der mit dem Rücken zum Eingang gestanden hatte und sich nun verblüfft zu ihm umwandte.
»GNR – keiner rührt sich!«
Dazu zückte Luís Dias mit der freien Hand einen kreditkartengroßen Dienstausweis.
»Das fass ich nicht«, stieß Graciana hervor.
»Das ist Amtsanmaßung«, wusste Leander Lost.
»Der Hintermann in Lissabon ist passé«, sagte Graciana mit angespannter Stimme, »an den kommen wir dieses Mal nicht ran.«
»Ja, und außerdem versaut Luís uns gerade den Zugriff«, sagte Carlos. »Wenn Serra glaubt, dass Victor Pais mit Luís unter einer Decke steckt, ist er praktisch tot.«
Kaum hatte er das ausgesprochen, sprintete Graciana schon los, ihre Rechte flog nach hinten, um den Knauf ihrer Dienstwaffe zu umfassen.
»Carlos, Hintereingang!«, rief sie noch.
Esteves reichte das Tablet an Lost und machte sich im Laufschritt auf den Weg.
»Du«, sagte Luís Dias gerade und zielte jetzt auf Bruno Melo, der neben dem Eingang stand, »mit dem Bauch auf den Boden und Hände hinter den Kopf.«
Melo kam dem Befehl sofort nach.
Ein winziger Moment der Unachtsamkeit, den Serra nutzte, um den Kofferdeckel zu schließen. Aber schon richtete sich die Mündung von Dias’ Waffe auf ihn.
»Finger weg von dem Koffer.«
Serra schluckte – und warf Pais einen hasserfüllten Seitenblick zu: »So viel Zufall gibt es nicht.«
»Ich schwöre, ich hab nichts damit zu tun«, flüsterte der Tausendsassa, der gerade recht blass wurde.
»Du kannst dich verkriechen, wo du willst – ich finde dich«, sagte Serra heiser vor Wut.
Luís Dias ging auf die beiden zu, aber er verhakte sich mit dem rechten Fuß hinter etwas – Melos Hände.
Luís stürzte. Kaum war er zu Boden gegangen, sprang Serra vor, um die Glock, die Luìs entglitten war, aufzuheben. Bruno Melo war im Nu über ihm und verpasste ihm einen Schlag auf den Hinterkopf, so wuchtig, dass Luís der Blick verschwamm.
Der Tausendsassa wusste, was die Stunde geschlagen hatte.
Zwei Stufen auf einmal nehmend flitzte er die Treppe hinauf, knapp an der obigen Überwachungskamera vorbei. Aber auch Diogo Serra verlor keine Zeit – er wirbelte um seine Achse, ließ den Arm mit der Pistole hochschnellen und drückte zweimal schnell hintereinander ab, bevor die Bewegung endete.
Die beiden Projektile schlugen vor und über Pais in die Wand und die Decke ein und ließen den Putz herausschießen. Und obwohl er meinte, schon das Äußerste aus sich herauszuholen, mobilisierten die beiden Schüsse noch einmal ein Quäntchen mehr Kraft.
Lost, der auf dem Tablet sah, wohin Victor Pais flüchtete, blickte an der Fassade des Hauses gegenüber hinauf und registrierte aus den Augenwinkeln, wie Graciana die Tür zur Werkstatt des Tausendsassas erreichte.
Die aber gerade von innen von Bruno Melo abgeschlossen wurde.
»PJ, öffnen!«, rief Graciana und trat zur Seite, falls Serra auf die Idee kommen sollte, durch die Tür zu schießen. Aber wie sie erwartet hatte, kam keiner der beiden ihrer Aufforderung nach. Carlos hatte das Ende der Straße erreicht und lief weiter, um vielleicht durch ein Fenster auf der Rückseite in die Werkstatt einsteigen zu können.
»Nimm den Koffer«, rief Diogo Serra, der die Stufen ebenfalls hinauflief, Melo zu.
Leander Lost sah bei einem Nachbargebäude, wonach er suchte: eine Lücke in der Fassade. Ein Eingang mit verschlossener Tür – aber oberhalb davon keine abweisende Hauswand, sondern ein kleiner Innenhof, von dem eine Steintreppe auf die Dachterrasse führte.
Er sprang aus vollem Lauf an der Fassade hinauf, bekam den oberen Rand der Hausmauer zu fassen und zog sich hoch. Dann schwang er ein Bein hinüber und sah zu Miguel Duarte, der mit dem Tablet im Durchgang verharrte.
»Ich bleib hier, falls Sie zurück ins Erdgeschoss kommen«, rief er Lost zu, der daraufhin in den Innenhof sprang und die Treppe hinauflief.
»Was siehst du?«, rief Graciana Duarte zu.
»Pais haut aufs Dach ab – und die beiden hinterher.«
»Und Luís?«
»Liegt unten am Boden.«
Miguel löste sich von den Videobildern, weil er ihren Blick auf sich spürte. Ernst. Und ja, besorgt. Die Lippen aufeinandergepresst. Er wusste warum und erlöste sie: »Er rührt sich, er ist alleine.«
Sie atmete erleichtert durch und klopfte gegen die Tür.
»Luís, kannst du mich hören? Mach auf.«
Der Tausendsassa machte sich nicht die Mühe, die Fliegengittertür seines Schlafzimmers zu öffnen, sondern rannte einfach gegen sie, um keine Zehntelsekunde zu verlieren, sodass sie aufgeschleudert wurde und lautstark gegen die danebenliegende Wand schepperte.
Pais lief in Windeseile über die eigene Dachterrasse und schwang sich über die halbhohe Mauer seines Nachbarn.
Luft!
Keine Mauern. Keine Wände. Die Dachterrassen der Häuser bildeten, gegliedert durch halbhohe Mauern, eine durchgehende Fläche, aus der sich die rechteckigen, maurisch verzierten Rauchabzüge wie dünne Zeigefinger in die Nacht reckten.
Letztlich handelte es sich um eine gut zweihundert Meter lange Veranda mit unterschiedlichen Bewohnern.
Am Ende dieser Ebene, auf der Terrasse des letzten Gebäudes, gab es eine Tür. Und ein Vorhängeschloss. Mariana selbst hatte es dort angebracht, und weil sie sich Dinge schlecht merken konnte – insbesondere Zahlen – lautete der Code 333. Bei Issos Keilerei. Mariana unterrichtete in Olhão Geschichte. 333.
Was die Hälfte von 666 war, die Zahl des Tiers, des Antichristen. In einer katholisch geprägten Gesellschaft nicht die schlechteste Eselsbrücke. Und Mariana hatte ihm die 333 mit auf den Weg gegeben. Für einsame Nächte. Sie fand die Vorstellung romantisch, dass er des nachts, von unstillbarer Sehnsucht getrieben, über die Dächer und in ihre Wohnung schlich, um sich an sie zu schmiegen und sie mit einem Kuss zu wecken.
Das erste Mal war sie zu betrunken und das zweite Mal ihr Mann wider Erwarten doch nicht mehr auf einer Bohrinsel.
Hinter sich hörte er ein Scheppern – eines von einer eindeutigen Charakteristik, nämlich der des Fliegengitters, das er selbst gerade hinter sich gelassen hatte. Beim Laufen blickte er über die Schulter: Serra.
Serra, der kurz verharrte, um sich zu orientieren und der dann auf ihn anlegte. Aber der nicht schoss, weil Pais’ Vorsprung zu groß und der Schuss zu ungenau sein würde. Lieber setzte er dem Flüchtenden nach, denn auch ihm war klar, dass die Dachfläche all der Häuser endlich war und an ihrem Ende abrupt ins Nichts abfiel. Der Tausendsassa sprintete also exakt auf das Ende einer Sackgasse zu, das sich sechs, sieben Meter über dem Asphalt befand.
Victor Pais erreichte die Tür mit dem Vorhängeschloss und presste sich dabei seitlich gegen die Wand, um für Diogo Serra ein schwierigeres Ziel abzugeben. Seine Finger funktionierten trotz seiner aufkeimenden Panik wie eine frisch geölte Mechanik: 3 – 3 – 3. Zack.
Aber das Schloss öffnete sich nicht.
»Merda!«
Er zerrte und riss daran – nichts. Kette und Schloss zeigten sich unerbittlich. 2 – 2 – 2. Auch nicht.
4 – 4-
Der Schuss traf ihn mit einer Wucht, die er nicht vermutet hätte.
Die Kilojoule, die das Projektil mitbrachte, zwangen ihn zu drei Stützschritten nach hinten (3– 3 – 3), wobei der dritte buchstäblich ins Nichts führte, nämlich über die Dachkante hinaus.
Der Tausendsassa stürzte hinab. Geistesgegenwärtig packte er mit beiden Händen nach der Dachkante, aber gleichzeitig jagte ein Schmerz wie ein Elektroschock von seiner linken Schulter hinauf und über seine Hand in den linken Hinterkopf, um da zu explodieren. Ein lähmender, kaum auszuhaltender Schmerz.
Er hing sechs Meter über dem Boden, und er würde sich beide Beine und vielleicht sogar das Rückgrat oder den Hals brechen, aber der Schmerz seiner Schusswunde zwang ihn, die linke Hand von der Dachkante zu lösen.
Wieder ein Scheppern. Ein anderes. Klappriger. Ein Schusswechsel, an dem zwei unterschiedlich klingende Waffen beteiligt waren.
Was passierte dort? Die Sub-Inspektorin vielleicht? Eilte sie ihm zu Hilfe – war sie schneller als Serra? Wenn er abstürzte und dabei nicht umkam, würde er mit gebrochenen Knochen hilflos auf der Straße liegen. Serra müsste nur noch abdrücken.
Ein unterdrückter Fluch.
Serra.
Ein Ächzen. Nicht von Serra – aber von wem?
Wieder zwei Schüsse.
Der erste ging ins Nichts. Der zweite prallte von etwas ab.
Von Metall oder Blech. Das Jaulen des Querschlägers verriet es.
Dann näherten sich Schritte.
Er stöhnte auf. Seine Finger gerieten ins Rutschen und sein Rücken wurde jetzt am Schulterblatt sehr nass. Die Schweißperlen auf seiner Stirn waren eiskalt.
Mit einem Mal stand ein Schatten über ihm, umrahmt von einem dunklen Rechteck.
Aus dem Schatten erwuchs ein Arm, schwarz. Mit einem weißen Rand um die Hand – der Hemdsärmel.
Es war der Mann mit dem unbeweglichen Gesicht, der über ihm stand und ihm die Hand reichte. Die andere benutzte er dazu, seinen Rücken mit dem dunklen Rechteck zu decken.
Ein trockener Schuss ertönte und traf auf das Rechteck, mit dem Leander Lost sich schützte. Das Projektil surrte deformiert davon.
Pais griff zu und Lost zog ihn hinauf aufs Dach. »Bleiben Sie unten«, wies Leander den Verletzten an, der jetzt wiederum sah, was es mit dem Rechteck auf sich hatte. Victor Pais war es ein Rätsel, wie er sie aus den Angeln gehoben und hinter sich her geschleift hatte, aber was der Mann mit dem regungslosen Gesicht als Kugelfang und Deckung benutzte, ohne die sie beide hier an der Dachkante ideale Zielscheiben für Serra abgegeben hätten, war eine komplette Brandschutztür. In deren Obhut gelangten sie hinter einen Aufbau aus Beton, der sie abschirmte. Und den Leander Lost nun mit vorgehaltener Waffe und ohne Brandschutztür verließ. Serra, gute zehn Meter entfernt, feuerte auf ihn und etwas von dem Aufbau direkt neben Lost wurde abgerissen. Bevor Leander Lost das Feuer erwidern konnte, ertönte ein trockenes Schussgeräusch – eine 26er Glock –, mit der Graciana Rosado, mittlerweile von Luís Dias ins Haus gelassen, Diogo Serra am Bein traf, der daraufhin mit einem unterdrückten Schmerzensschrei zu Boden ging. Es war vorbei.
Nur 20 Minuten später waren Serra und seine rechte Hand Melo von GNR-Einheiten in den Krankentrakt der JVA von Faro abtransportiert worden.
Der Notarzt stoppte die Blutung aus Pais’ Schulterwunde noch auf dem Dach. Nachdem man den Tausendsassa auf die Trage geschnallt hatte und die Sanitäter sie anhoben, gab er mit der Hand ein Zeichen und bat Leander Lost zu sich: »Sie haben einen gut bei mir, Senhor Lost.«
»Einen was? Was meinen Sie?«
»Einen Gefallen – egal, was Sie brauchen. Ich besorg’s Ihnen.«
Und mit diesem Versprechen auf den Lippen transportierte man ihn ab.