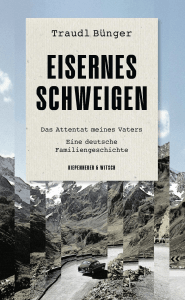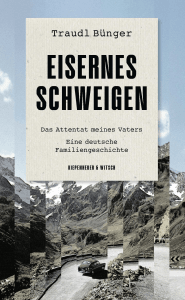Traudl Bünger über »Eisernes Schweigen«

Wie haben Sie vom Attentat Ihres Vaters erfahren?
Dass mein Vater angeklagt war, in Italien Attentate verübt zu haben, war für mich immer ein offenes Geheimnis. Aber ich wusste nicht, ob er zu Recht oder zu Unrecht angeklagt war. Denn mein Vater hat nie mit mir darüber gesprochen. Weder hat er die Attentate zugegeben, sich erklärt oder verteidigt, noch hat er bestritten, sie begangen zu haben. Seine Reaktion auf jede Frage, ob wütend, dringlich oder neugierig, war immer nur ein tiefes Schweigen. Einmal habe ich als Kind einen Zeitungsartikel gelesen. Ich glaube, meine Schwester hatte ihn irgendwo gefunden. Ich habe nicht allzu viel verstanden, nur, dass meinem Vater vorgeworfen wurde, an mehreren Attentaten in Italien beteiligt gewesen zu sein. Nach dieser Lektüre habe ich versucht, mit ihm zu sprechen. Antworten bekommen habe ich nicht.
Wie war es für Sie, dem Geheimnis Ihres Vaters auf den Grund zu kommen?
Es war anspruchsvoll, befreiend und überfordernd. Puzzlestein um Puzzlestein habe ich Ermittlungen und Gerichtsunterlagen aus drei Ländern zu einem Bild zusammengesetzt. Ich war Ermittlerin, Historikerin und Tochter. Und fand bestätigt, was ich immer gespürt habe: Dass es etwas Großes, Dunkles und Beängstigendes im Leben meines Vaters gibt, das er vor mir verschloss. Etwas, das mit seiner rechtsextremistischen Haltung zu tun hat, das aber auch darüber hinausweist. Diese Erkenntnis war klärend und überfordernd zugleich und ist es immer noch. Denn was ich da rausgefunden habe, betraf ja nicht irgendwen, sondern meinen Vater, der für mich da gewesen ist, den ich liebe. Und den ich zugleich für seine Haltung und für seine Taten verurteile. Ein Widerspruch, kaum auflösbar.
Warum ist die Geschichte Ihres Vaters für heutige Leser*innen relevant?
Als Kind war ich zweimal in Ferienlagern des „Bund Heimattreuer Jugend“. In diesem Bund aktiv war auch der Initiator des Potsdamer Treffens vom November 2023, bei dem die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert wurde. Diese Treffen stehen in einer langen Tradition, die ich heute kenne: Bereits wenige Jahre nach dem Krieg waren diese Netzwerke wieder da. Sie schufen Räume für Ideologie, zum Schmieden von Plänen, zum Vorbereiten von Aktionen: Angriffe auf die Demokratie, Ausgrenzung und Gewalt. Hier traf mein Vater als junger Mann Gleichgesinnte, mit denen er in den frühen Sechzigern nach Italien fuhr, um Attentate zu begehen. Diese Netzwerke sind nie verschwunden, sie haben Erinnerungskultur und Bewusstseinswandel überlebt und heute in der AfD sogar parlamentarische Wirksamkeit gewonnen. Meine Geschichte zeigt, wie gefährlich diese Strukturen von Beginn an waren und immer noch sind. Sie zeigt auch, wie der Staat im Umgang mit ihnen schlingert. Wie wichtig es ist, wachsam zu sein: im Hinschauen, im Urteilen und im Handeln. Als Staat und als Zivilgesellschaft.